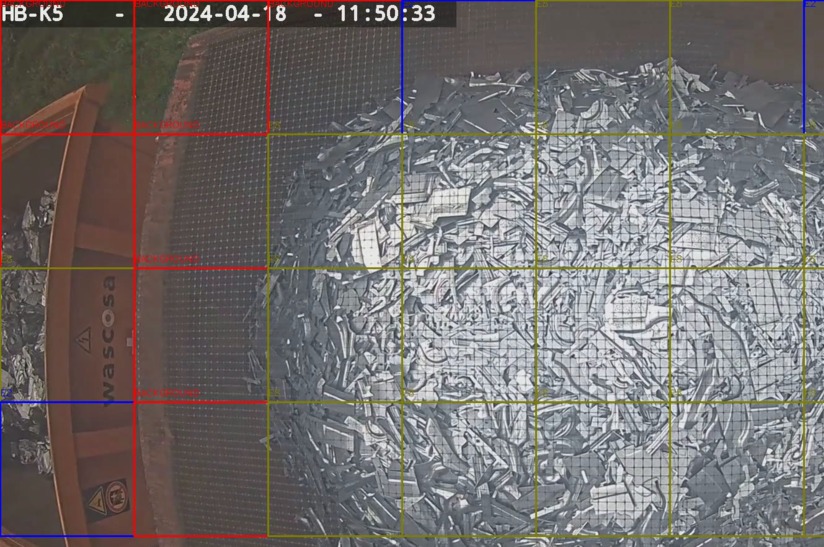- Fragen & Antworten
- Mein Konto
- Newsletter
- Kontakt
- Redaktion: +49 2203 3584 0
- Abo-Service: +49 40 23670 300
- Mein Konto
- Logout

Die additive Fertigung – gemeinhin auch 3D-Druck – ist weiter auf dem Vormarsch. In einem neuen Forschungsprojekt will ein Entwickler-Team nun Grundlagen erarbeiten, die für eine hochwertige industrielle Produktion die Voraussetzung sind. Insgesamt 15 Unternehmen und Hochschulen beabsichtigen, bis 2022 neue Verfahren beispielsweise für die Automobilindustrie oder den Maschinenbau zu erschließen.
Mit neuen Standards will das Forschungsprojekt „Linienintegration Additive Fertigung“ die Basis für einen technologischen Vorsprung legen und dadurch Wettbewerbsvorteile für viele Unternehmen ermöglichen, schildert Lukas Löber von Bosch. Der promovierte Ingenieur ist mit der Leitung des Vorhabends betraut. Mit additiven Fertigungsverfahren – wie der 3D-Druck korrekt heißt – entstehen bereits heute hochkomplexe Strukturen aus Kunstoff oder auch Metall. So entstehen interessante Einzelstücke, die allerdings handwerklich weiterverarbeitet werden.
„In der Industrie wollen wir jedoch gleiche Produkte tausendfach auf einer Fertigungslinie herstellen und das bei konstant gleicher Qualität“, erklärt Löber. Erst wenn dieser Sprung gelinge, könne die noch junge Technologie ihr ganzes Potenzial entfalten und vielen Branchen den Weg zu neuen Produkten ebnen.
Das Forschungsprojekt umfasst Themen entlang der gesamten Prozesskette. Untersucht werden unter anderem die zusätzlichen Möglichkeiten der Produktgestaltung, die Eigenschaften und Weiterentwicklungen der eingesetzten Werkstoffe sowie die einzelnen Schritte im Fertigungsprozess und der Weiterverarbeitung.
Die Technologie, die im Fokus steht, ist das Laser-Strahlschmelzen (kurz L-PBF-M). Das Verfahren schmilzt aufgetragenes Metallpulver punktgenau und bringt es so in Form. Der Prozess verläuft nach Angaben der Projektpartner jedoch nicht immer zuverlässig stabil, was zu Fehlern in den Bauteilen führen kann. Diese Herausforderung soll mit einer intensiven Prozessüberwachung gelöst werden.
Das Projekt will aber noch mehr Hürden auf dem Weg zur industriellen Anwendung nehmen. So baut der Drucker die Teile auf einer Plattform auf, die anschließend wieder abgetrennt werden muss. „Diesen Schritt müssen wir auf eine industrielle Basis bringen“, so Löber. Dies sei auch für die mechanischen oder thermischen Bearbeitungsschritte notwendig.
Ferner gilt es, die eingesetzten Materialien zu erforschen. „Metalle kühlen bei dieser additiven Fertigungstechnologie viel schneller ab. Dadurch entstehen völlig neue Eigenschaften im Werkstoff“, erläutert Löber. Die Entwickler wollen rund um all diese Fragen einheitliche Verfahren und somit auch neue Standards erarbeiten.
Die Projektteilnehmer erhoffen sich auch, dass durch ihre Arbeit die Möglichkeiten durch die additive Fertigung bekannter werden. Das Grundwissen ist noch nicht weit verbreitet, denn die Technologie wird erst seit knapp zwei Jahrzehnten für einzelne Lösungen angewendet. „Entsprechend ziehen kaum Entwickler den 3D-Druck in Betracht, wenn sie über neue Produkte und deren Herstellungsschritte nachdenken“, meint Löber. Dabei seien mit der additiven Fertigung interessante Formen und Lösungen möglich, die mit herkömmlichen Verfahren nie erzielbar wären.
Das Forschungsprojekt zählt zum Programm „Forschung Photonik Deutschland“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Es umfasst ein Volumen von 13,6 Millionen Euro, wovon 6,9 Millionen Euro direkt vom BMBF gefördert werden.
Erhalten Sie exklusiven Zugriff auf alle Fachartikel, Whitepaper und Analysen.