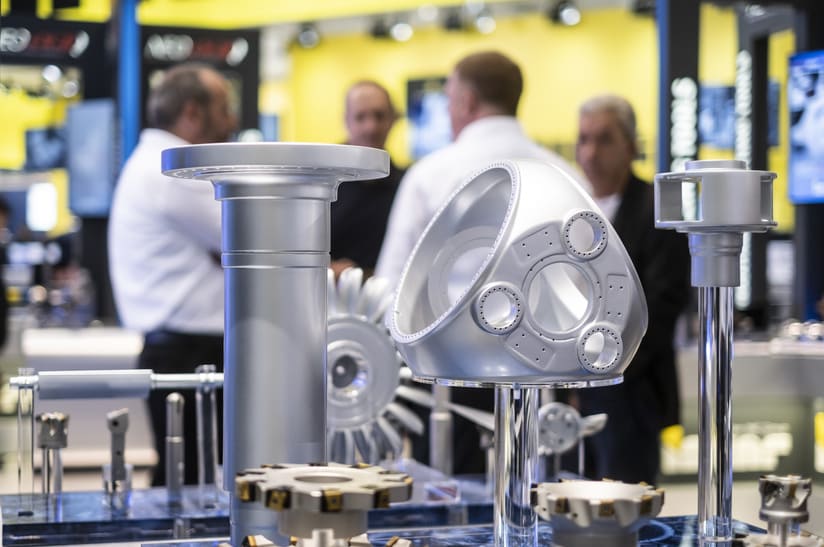- Fragen & Antworten
- Mein Konto
- Newsletter
- Kontakt
- Redaktion: +49 2203 3584 0
- Abo-Service: +49 40 23670 300
- Mein Konto
- Logout

Die WV Stahl sieht im Bundesratsvotum für den EU-Stahlaktionsplan ESMAP ein wichtiges Signal für den Standort. Jetzt müsse die Bundesregierung zügig handeln, um Beschäftigung, Wertschöpfung und Klimaziele zu sichern.
In seiner letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause am 11. Juli hat der Bundesrat aus Sicht der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) ein „wichtiges Signal für eine starke, zukunftsfähige Stahlindustrie in Deutschland“ gesendet. Mit breiter Mehrheit hat die Länderkammer einen Entschließungsantrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur zügigen Umsetzung des Europäischen Stahl- und Metallaktionsplans (ESMAP) angenommen. Auf Antrag der Länder Saarland, Bremen und Niedersachsen wurde zudem die wichtige Forderung nach einem nationalen Stahlgipfel aufgenommen.
„Wir danken den Bundesländern für das starke Votum für den Stahlstandort Deutschland und unterstützen die Forderung nach einem Spitzengespräch der Bundesregierung mit unserer Branche“, erklärt Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl. „Denn es ist dringend nötig, dass die Regierung jetzt geeint die Umsetzung der im Koalitionsvertrag gemachten Ankündigungen angeht und sich in Brüssel für die Umsetzung des Europäischen Stahl- und Metallaktionsplans stark macht.“
Worauf es für die WV Stahl jetzt ankommt:
„Ohne eine rasche Umsetzung dieser lange bekannten Maßnahmen, droht der Verlust zehntausender Arbeitsplätze, der Verlust der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands, der Verlust unserer Resilienz“, mahnt Rippel.
Besonders dringend sei die Schaffung eines nachhaltig wirksamen Außenhandelsschutz-Instruments. Denn dort sei die Entwicklung besorgniserregend. Schon heute stammt jede dritte in der EU verbrauchte Tonne Stahl aus dem Nicht-EU-Ausland. In Kombination mit einer historisch niedrigen Stahlnachfrage führe dies zu einer drastischen Unterauslastung der deutschen und europäischen Stahlkapazitäten. Verstärkt werde der Importdruck durch die nach wie vor geltenden US-Stahlzölle in Höhe von 50 Prozent. Und die Zukunft sehe düster aus. Nach Berechnungen der OECD wachsen die weltweiten Überkapazitäten von 600 Millionen Tonnen (2024) bis 2027 auf über 700 Millionen Tonnen an – sofern kein Gegengesteuern erfolge. „Es wird höchste Zeit für ein langfristig wirksames europäisches Handelsschutzinstrument – unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch“, betont Rippel. „Andernfalls werden Deutschland und die gesamte EU zum großen Verlierer der geopolitischen Neuordnung!“
Auch die lange versprochene Senkung der Energiekosten müsse endlich politisch umgesetzt werden. „Die im internationalen Vergleich immer noch zu hohen Strompreise und die seit mittlerweile anderthalb Jahren massiv gestiegenen Netzentgelte treffen ausgerechnet die schon heute besonders klimafreundlich produzierenden Elektrostahlwerke – und gefährden zudem den Umbau unserer Branche zur Klimaneutralität“, so Rippel. „Deshalb muss die Senkung der Übertragungsnetzentgelte jetzt schnell umgesetzt werden. Jeder Monat an Entlastung zählt hier! Und auch langfristig muss der Standortnachteil ‚Energiepreise‘ angegangen werden. Wir brauchen einen wettbewerbsfähigen, verlässlichen Industriestrompreis – so wie in Frankreich schon seit Jahren, und in Italien seit diesem Frühjahr möglich. Der Beihilferahmen hat hier die Tür einen Spalt breit geöffnet. Jetzt ist es an der Bundesregierung ein Konzept vorzulegen, das die energieintensive Industrie auch tatsächlich entlastet.“
Eine große Chance, wirtschaftliche Impulse zu setzen, konjunkturelles Wachstum anzuregen und die strategische Resilienz zu stärken liege für die Stahlindustrie in Deutschland in der Schaffung von Leitmärkten für emissionsarme Grundstoffe „Made in Germany und EU“. Insbesondere das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz biete die Möglichkeit die Konjunktur wieder anzureizen – jedenfalls dann, wenn die Politik auf räumlich nahe gelegene Wertschöpfung setzten. „Wer Wachstum, Resilienz und Klimaschutz will, muss unsere regionale Wertschöpfung gezielt stärken“, so Rippel.
Jetzt komme es auf Tempo bei der Umsetzung an. Damit industrielle Wertschöpfung, Beschäftigung und der Umbau zur Klimaneutralität in Deutschland und Europa gesichert werden, brauche es sofort entschlossenes politisches Handeln.
Foto: MWIDE/C.S.
Erhalten Sie exklusiven Zugriff auf alle Fachartikel, Whitepaper und Analysen.